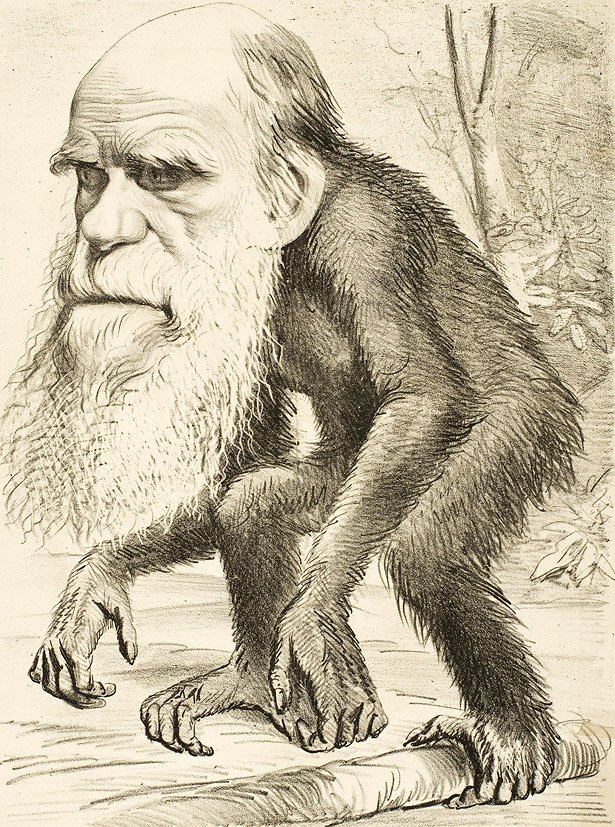Hummeln gehören eindeutig zu den fliegenden Insekten – dennoch hält sich die Annahme, dass sie nach physikalischen Gesetzen nicht fliegen können dürften. Dies wird häufig als Anekdote verbreitet, die zeigen soll, dass manche Naturgesetze noch nicht ausreichend verstanden sind: Wie man sieht, können Hummeln sehr wohl fliegen. Wenn physikalische Gesetze anderes behaupten, müsse das also an diesen Gesetzen liegen, nicht an der Hummel.

Hummeln sind Flugkünstler, und die Gesetze der Physik behaupten nichts anderes. © FreeImages.com / Tamas Nyari
Doch die Gesetze der Physik widersprechen auch in diesem Fall nicht der Natur. Ursprung dieses Irrglaubens ist wahrscheinlich ein Scherz unter Insektenforschern und Physikern zu Anfang der 1930er Jahre: In einer kurzen Überschlagsrechnung stieß ein Physiker darauf, dass Hummeln im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht viel zu kleine Flügel haben. Nach aerodynamischen Strömungsregeln allein könnten sie damit nicht genug Auftrieb erreichen, um ihren Luftwiderstand zu überwinden und zu fliegen.
Hummel-Scherz unter Wissenschaftlern
Die Anekdote taucht auch im Buch „Der Flug der Insekten“ des französischen Insektenforschers Antoine Magnan auf. Es ist aber unwahrscheinlich, dass die Forscher und ihre Zeitgenossen die Berechnungen für bare Münze nahmen. Tatsächlich ist die Physik hinter dem Flug der Insekten mittlerweile gut erforscht und beschrieben.
Wären Hummeln Flugzeuge, könnten sie bei ihrem Körpergewicht im Verhältnis zur Fläche ihrer Flügel in der Tat nicht fliegen. Doch den Hummeln kommen zwei Dinge zugute: Erstens sind sie viel kleiner und leichter als ein Flugzeug. Die Luft, durch die sie fliegen, bleibt aber genauso dicht. Daher gelten für die Luftströmungen um ihre Flügel völlig andere Bedingungen, und auf Flugzeug-Aerodynamik basierende Rechnungen liefern zwangsläufig irreführende Ergebnisse.
Erfolgreiche Insekten-Hubschrauber
Hinzu kommt, dass die Flügel der Hummel nicht starr stehen wie bei einem Flugzeug und auch nicht bloß einfach auf und ab schlagen. Stattdessen rotiert die Hummel ihre Flügel rasend schnell, so dass sich der Winkel zur anströmenden Luft im Flug ständig ändert. Dadurch erzeugt das Insekt Luftwirbel, die stark genug sind, um den Körper in die Luft zu heben.
Der Hummelflug ähnelt in diesem Aspekt eher einem Hubschrauber als einem Flugzeug. Damit sind Hummeln sogar so erfolgreich, dass sie mit gut 5.000 Metern die höchste Flughöhe von allen Insekten erreichen und auch in extrem dünner Luft noch fliegen können.
Zecken fallen nicht von Bäumen
Im Gegensatz zu Hummeln können Zecken nicht fliegen – und sie versuchen es auch nicht. Entgegen dem verbreiteten Glauben stürzen sie sich jedoch nicht von Bäumen herab auf ihre Opfer. Diese Strategie wäre für diese blutsaugenden Spinnentiere viel zu riskant: Das Klettern auf einen Baum kostet viel Zeit und vor allem Energie und der Sprung auf einen möglichen Wirt hat zu geringe Erfolgschancen.
Stattdessen kommen Zecken aus der entgegengesetzten Richtung: Sie lauern an Grashalmen oder im Gebüsch, oft sogar fast auf Bodenhöhe. Einen Wirt, wie etwa einen Menschen beim Spaziergang, ein streunendes Haustier oder ein Schaf auf der Weide, erkennen sie durch dessen Geruch und Atemluft, aber auch an Vibrationen durch Schritte oder einen Schatten, der die Zecke streift.
Sobald sie ein solches Signal wahrnimmt, streckt eine Zecke ihre vorderen Beine weit von sich und hält sich nur noch mit den hinteren Beinpaaren an ihrem Lauerplatz fest. Streift der vorbeikommende Wirt daran entlang, packt die Zecke sofort zu und lässt sich mitnehmen. Diese Vorgehensweise verspricht viel mehr Erfolg und ist deutlich weniger anstrengend als der angebliche Sprungangriff von einem Baum herab.
Ansgar Kretschmer
Stand: 15.01.2016