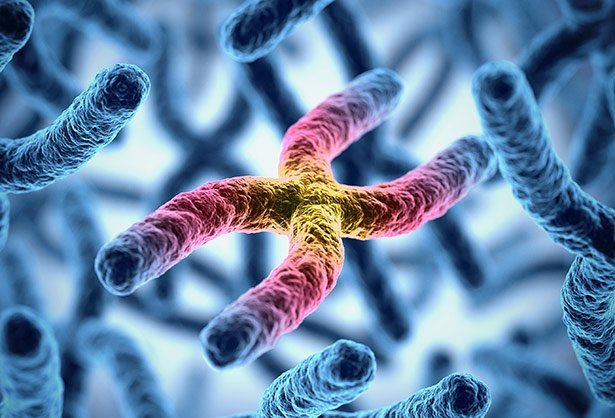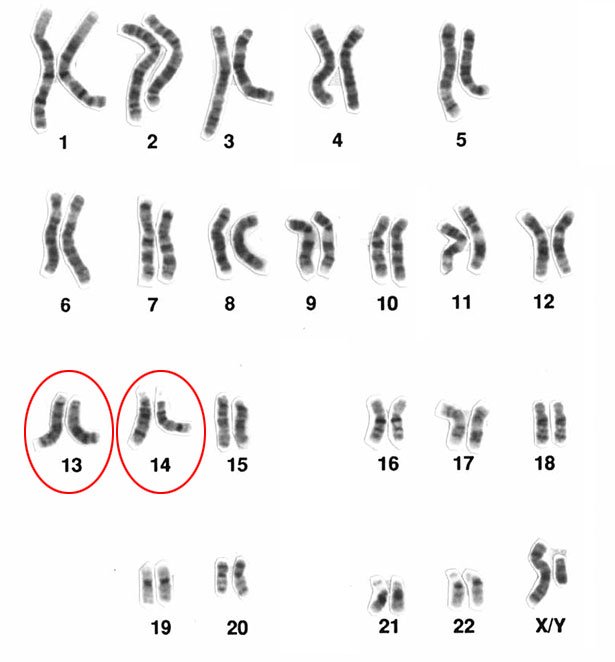Pinguine tun es, Delfine und auch Menschenaffen: Homosexualität ist keineswegs eine Domäne nur des Menschen. Verschiedene Spielarten gleichgeschlechtlicher Sexualität kommen auch im Tierreich vor – und das überraschend häufig. Schon mehr als 1.500 Tierarten haben Forscher bei homosexuellem Verhalten „ertappt“. Die Spanne reicht von wirbellosen Insekten über Vögel bis hin zu Säugetieren.

Kehlstreifpinguin (Pygoscelis antarctica) bei der Jungenaufzucht. © NOAA
Die Geschichte von Roy und Silo
Das vielleicht bekannteste Beispiel sind die Kehlstreifpinguine Roy und Silo. Wer im Jahr 1998 den New Yorker Zoo besuchte, dem erschienen diese beiden Pinguine auf den ersten Blick eher unspektakulär: Sie fraßen, tauschten zärtliche Rufe aus und waren insgesamt unzertrennlich. Wie für Pinguinpaare üblich, paarten sie sich schließlich und bauten ein gemeinsames Nest.
Das Besondere aber: Roy und Silo waren beide Männchen – was sie nicht weiter zu stören schien. Weil sie selbst keine Eier legen konnten, holten sie sich einfach einen rundlichen Stein als Ersatzei ins Nest. Später erbarmten sich die Tierpfleger und legten den beiden eifrig brütenden Pinguinen das verwaiste Ei eines anderen Paares ins Nest. Als das Küken nach 34 Tagen schlüpfte, erwiesen sich Roy und Silo als aufopferungsvolle und erfolgreiche Väter: Sie wärmten es und fütterten es mit herausgewürgtem Futter
Nur ein Symptom der Gefangenschaft?
Inzwischen ist klar, dass Roy und Silo kein Einzelfall sind. Auch in anderen Tiergärten haben Biologen seither gleichgeschlechtliche Pinguinpaare beobachtet. Doch gehört dies zum natürlichen Verhaltensspektrum dieser Vögel? Immerhin leben Roy, Silo und die anderen nicht wild, sondern in Gefangenschaft – und damit nicht unter natürlichen Bedingungen. Auch viele andere Beobachtungen von homosexuellem Verhalten bei Tieren stammen aus Zoos und Tierparks.
Einige Forscher vermuten daher, dass zumindest ein Teil dieser gleichgeschlechtlichen Paarungen eine Reaktion auf das Leben in Gefangenschaft sind. Der erhöhte Stress und manchmal auch ein Mangel an passenden Partnern des anderen Geschlechts könnte die Tiere sozusagen zu Not-Partnerschaften zusammenbringen. Dazu würde passen, das auch domestizierte Tierarten wie Schafe und Rinder häufiger homosexuelles Verhalten zeigen als ihre wilden Verwandten.
Termiten und Trauerschwäne
Doch das kann nicht erklären, warum einige Tierarten auch in freier Wildbahn homosexuelle Beziehungen eingehen. Beispiele dafür gibt es bei Fischen, Reptilien, Meeressäugern, Vögeln, Affen und auch bei Insekten: Bei japanischen Termiten finden sich manchmal junge Männchen zusammen und bauen gemeinsam ein Nest wie Forscher vor kurzem entdeckten. Mangels Nachwuchs können diese „schwulen“ Termiten zwar keine neue Kolonie gründen, ihr Männerbund verschafft ihnen aber gegenüber „Single-Männchen“ einen Überlebensvorteil.
Ähnlich könnte es bei wilden Trauerschwänen sein: Bei diesen Vögeln finden sich ebenfalls manchmal zwei Männchen zusammen, bauen ein Nest und klauen sich dann von Nachbarpaaren ein Ei zum Bebrüten. „Weil diese Männerpaare zusammen stärker und größer sind als ein Paar aus Männchen und Weibchen, sind sie bei Nestbau und Brut sehr erfolgreich“, erklärt Petter Boeckman vom Naturkundemuseum in Oslo. „Einen gleichgeschlechtlichen Partner zu haben, kann sich daher für sie durchaus auszahlen.“
Bisexuelle Bonobos
Grundsätzlich bisexuell scheinen dagegen die Bonobos zu sein. Diese uns eng verwandten Menschenaffen sind ohnehin dafür bekannt, dass sie Sex in nahezu jeder Lebenslage praktizieren: zur Beschwichtigung, um sich Unterstützung zu sichern oder um Konflikte zu lösen. Nach dem Motto „make love not war“ ist der Sex bei ihnen der Kitt im sozialen Gefüge. Dabei scheinen die Affendamen und -herren in Bezug auf das Geschlecht ihres jeweiligen Partners wenig wählerisch zu sein.

Bonobos beim Sex. Bei diesen Menschenaffen ist rund die Hälfte der sexuellen Aktivität gleichgeschlechtlich. © Rob Bixby/CC-by-sa 2.0 Wie Biologen beobachtet haben, ist rund die Hälfte der sexuellen Aktivität bei Bonobos gleichgeschlechtlich. Im Regenwald des Kongo laden die Damen dabei ihre Artgenossinnen mit unmissverständlichen Hüftbewegungen zum Techtelmechtel ein. Für junge Bonobo-Mädchen ist der Sex mit älteren Weibchen sogar eine Art Initiation ins Erwachsenenleben: Sie verlassen typischerweise ihre alte Familie und schließen sich einer neuen Gruppe an. Dort verschaffen sie sich ihren Platz in der sozialen Rangordnung durch ausdauernde Fellpflege – und Sex mit den alteingesessenen Weibchen.
Ein Darwinsches Paradox
All diese Beispiele sprechen dafür, dass homosexuelle und bisexuelle Neigungen in der Natur zwar nicht die Regel sind, aber durchaus häufig vorkommen. Das allerdings weckt die Frage nach dem Warum. Denn rein evolutionär gesehen sind gleichgeschlechtliche Paarungen eine Sackgasse: Weil sie keine Nachkommen hervorbringen, tragen sie nicht zum Fortbestand der Art bei. Gleichzeitig müssten damit auch alle genetischen Anlagen für eine Homosexualität im Laufe der Zeit aussterben.
Eine mögliche Erklärung bietet der Onkel- und Tanten-Effekt: Weil homosexuelle Tiere keine eigenen biologischen Nachkommen haben, haben sie Zeit und Ressourcen, um sich um den Nachwuchs ihrer engsten Verwandten zu kümmern. Als Tanten oder Onkel können sie die Familien ihrer Geschwister unterstützen und so deren Überleben und Reproduktionserfolg verbessern, so eine der gängigsten Theorien. Tatsächlich ergab eine Studie bei einem Naturvolk auf Samoa, dass die dortigen Fa’afafine – relativ feminine homosexuelle Männer – häufiger bei der Versorgung und Erziehung ihrer Nichten und Neffen helfen.
In eine ähnliche Richtung, aber mit stärkerem Fokus auf die Genetik, geht eine weitere Hypothese: Die Gene, die beispielsweise bei Männern eine Homosexualität fördern, könnten nah verwandten Frauen Fortpflanzungsvorteile bringen. Das Prinzip dahinter kann man sich ähnlich vorstellen wie bei der Sichelzelle-Anämie: Wer zwei Allele dieser Genvariante trägt, erkrankt schwer. Wer aber nur ein Allel trägt, bleibt gesund und ist gegen Malaria geschützt – ein klarer Evolutionsvorteil.
Bisher allerdings gibt es kaum Belege für diese Hypothese. Zwar haben italienische Forscher in einer Studie tatsächlich Hinweise auf eine höhere Fortpflanzungsrate von Frauen mit homosexuellen Brüdern oder Onkeln gefunden. Ob dies aber tatsächlich auf diesen Effekt zurückgeht, lässt sich nicht beweisen – und auch reproduziert werden konnte diese Studie bisher nicht.
Warum homosexuelle Neigungen existieren, bleibt daher vorerst eines der großen Rätsel der Natur.
Nadja Podbregar
Stand: 29.06.2018