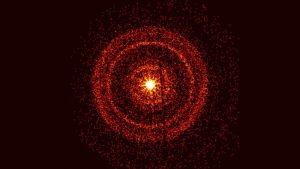Normalerweise dauert es hunderte bis tausende von Jahren, bis sich die Magmenkammer unter einem Vulkan füllt. Doch es gibt auch Feuerberge mit einem „Direktanschluss zur Hölle“: Als der Irazú in Costa Rica im Jahr1963 ausbrach, brauchte Magma aus dem Erdmantel nur wenige Monate, um aus 32 Kilometern Tiefe an die Oberfläche zu strömen. Diese Direktleitung machte die Eruption nicht nur schnell, sie förderte auch ständig Nachschub und ließ sie daher lange andauern. Das Wissen um solche „Highways to hell“ unter Vulkanen könne künftig dazu beitragen, Vulkanausbrüche besser vorhersagen zu können, konstatieren US-Forscher im Fachmagazin „Nature“.
Der Irazú in Costa Rica gehört zu den relativ aktiven Vulkanen des pazifischen Feuerrings. Etwa alle 20 Jahre bricht der „grollende Berg“ aus -mit mehr oder weniger verheerenden Folgen. So richtete seine letzte Eruption im Jahr 1994 nur wenige Schäden an, im Jahr 1963 aber dauerte der Ausbruch mehr als zwei Jahre, tötete 20 Menschen und begrub hunderte von Gebäuden unter Aschen und Schlamm. Damals gab es nur wenig Vorwarnung, die Eruption begann relativ überraschend.
Direktleitung in den Erdmantel?
Aber warum? Nach gängiger Theorie bahnt sich ein Ausbruch über lange Zeitperioden an: Nur allmählich, im Laufe von hunderten oder gar tausenden von Jahren steigt Magma aus dem Erdmantel in die Erdkruste auf und sammelt sich in Magmenkammern einige Kilometer unter dem Vulkan. Erst wenn dann dort der Druck auf kritische Werte ansteigt, beginnt die Eruption und leert dabei die Kammer wieder. Doch der Ausbruch des Irazú im Jahr 1963 passte nicht in dieses Schema, er begann zu schnell und hielt zu lange an – er spie mehr Asche und Lava als das Magmenreservoir eigentlich hergeben kann.
„Es muss eine direkte Leitung vom Mantel in die Magmenkammer geben“, sagt Terry Plank vom Lamont-Doherty Earth Observatory der Columbia University in New York. „Quasi einen Highway from Hell.“ Gemeinsam mit seinem Kollegen Philipp Ruprecht machte sich Plank auf die Suche nach Indizien dafür. Fündig wurden sie in Kristallen des Minerals Olivin, die bei der Eruption 1963 mit der Vulkanasche über die Umgebung verteilt worden war.
Verräterische Nickelspitzen im Kristall
Wenn aufsteigendes Magma aus dem Erdmantel abkühlt, bildet es Kristalle, die die Bedingungen, unter denen sie gebildet wurden, in ihren Eigenschaften konservieren. Tatsächlich stießen die Forscher in den Olivinproben auf erhöhte Nickelwerte, die darauf hindeuteten, dass das an die Oberfläche geförderte Magma so frisch aus dem Mantel kam, dass das Nickel keine Zeit hatte, sich gleichmäßig zu verteilen. Nach Berechnungen der Wissenschaftler muss das Magma innerhalb weniger Monate aus mehr als 32 Kilometern Tiefe aufgestiegen und ausgespien worden sein – für geologische Verhältnisse geradezu rasend schnell.
„Wenn wir damals schon seismische Überwachungs-Instrumente vor Ort gehabt hätten, hätten wir diese tiefen Magmen rechtzeitig kommen sehen“, sagt Ruprecht. „Wir hätten dann bereits Monate vorher eine Vorwarnung gehabt anstatt nur wenige Tage.“ Allerdings: Selbst die warnenden Vorbeben verraten meist nicht den genauen Eruptionstermin. Auch bei den Ausbrüchen des Pinatubo auf den Philippinen im Jahr 1991 und des Eyjafjallajökull auf Island kündigte sich die Eruption durch Beben an. Wann dann Asche und Lava tatsächlich ausbrechen und wann umliegende Ortschaften evakuiert werden müssen, ist nach wie vor schwer festzustellen.
Kein Einzelfall
Das Wissen darum, dass es bei einigen Vulkanen diese Form des schnellen Magmenaufstiegs gibt, könnte aber dabei helfen, besser einzuschätzen, wann tatsächlich eine Eruption droht und wie heftig sie voraussichtlich ausfallen wird. In jedem Fall ist ein „Highway to Hell“ wie beim Irazú nach Ansicht der Forscher kein Einzelfall. „Es ist ganz klar kein bloß lokales Phänomen“, kommentiert Susanne Straub vom Lamont-Doherty Earth Observatory.
Auch in Aschen von Vulkanen in Mexiko, Sibirien und den Cascades im Nordwesten der USA wurden bereits die verräterischen Nickelspitzen gefunden. Zurzeit untersuchen die Forscher Olivin-Kristalle von Vulkanausbrüchen auf den Aleuten, in Chile und auf Tonga. Zumindest einige von diesen könnte ihrer Meinung nach durchaus auch solche Direktverbindungen zum Mantel besitzen. (Nature, 2013; doi: 0.1038/nature12342)
(The Earth Institute at Columbia University, 01.08.2013 – NPO)