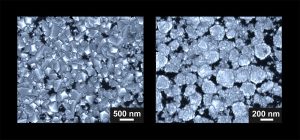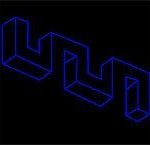Ob in der Liebe oder in der Politik, ob im Familien- oder Geschäftsleben, immer spielt das Vertrauen eine wichtige Rolle. Forscher der Universität Zürich haben jetzt neurobiologische Grundlagen dieses Verhaltens entdeckt. Danach kann das körpereigene Hormon Oxytocin dafür sorgen, dass Menschen Vertrauen zeigen.
{1l}
Ohne Vertrauen wäre der private, gesellschaftliche und politische Alltag nicht denkbar. So erfordert ein funktionierender Markt Vertrauen, denn wenn wir unseren Geschäftspartnern nicht ein Minimum an Vertrauen entgegenbringen, kommt kein Geschäft mehr zustande. Auch für die Demokratie gilt: wenn das Vertrauen in die politische Führung und die politischen Institutionen verloren geht, dann bricht die politische Legitimation zusammen. Der Gewinn, den wir aus unserem sozialen Verhalten ziehen können, hängt daher zu einem hohen Grad auch davon ab, wie stark unsere Fähigkeit ausgebildet ist, anderen zu vertrauen. Ohne Vertrauen wäre das Zusammenleben unerträglich.
Zahlreiche Forschungsergebnisse aus der Psychologie, den Rechtswissenschaften und der Ökonomie zeigen, wie wichtig soziale und institutionelle Randbedingungen für die Existenz von Vertrauen sind. So stärken etwa das Vertragsrecht und unabhängige Gerichte das Vertrauen in Geschäftsabschlüsse, indem sie für die Vollstreckung freiwilliger Vereinbarungen sorgen.
Vertrauensförderndes Hormon
Wenig weiss man hingegen noch über die Biologie des Vertrauens. Welche biologischen und psychologischen Voraussetzungen ermöglichen Menschen, Vertrauen auszubilden? Welche neurobiologischen Grundlagen tragen dazu bei, dass wir auch völlig Fremden unser Vertrauen schenken? Ein Forschungsteam der Universität Zürich mit den Wirtschaftswissenschaftlern Ernst Fehr, Michael Kosfeld und dem Psychologen Markus Heinrichs jetzt entdeckt, dass das Hormon Oxytocin eine wichtige Rolle für das menschliche Vertrauen spielt.
Testpersonen, denen Oxytocin durch die Nase verabreicht wurde, zeigten ein signifikant größeres Vertrauen in andere Menschen als Probanden, die ein Placebo erhielten.
Dieser Einfluss von Oxytocin auf das Vertrauen ist jedoch nicht einfach eine Folge einer allgemein angestiegenen Risikobereitschaft. Wie die Experimente der Zürcher Wissenschafter vielmehr deutlich machen, beeinflusst das Hormon spezifisch die individuelle Bereitschaft für soziale Risiken im Umgang mit anderen Menschen.
Erste Bausteine der Biologie des Vertrauens entdeckt
„Mit unserer Studie haben wir die ersten Bausteine der biologischen Basis von Vertrauen entdeckt“, erläutert Mitautor Michael Kosfeld.
„Unsere Ergebnisse eröffnen die aufregende Aussicht, bald noch weitere Bausteine der Biologie des prosozialen Verhaltens zu finden.“
Die Forschungsresultate stimmen mit den Ergebnissen aus der Forschung an Tieren überein, die auf die entscheidende Rolle von Oxytocin für prosoziales Verhalten hingewiesen haben. Bei nichtmenschlichen Säugetieren besitzt das Oxytocin eine Schlüsselposition für die Paarbindung, die mütterliche Fürsorge, das Sexualverhalten sowie die soziale Bindungsfähigkeit.
Außerdem vermindert das Hormon Ängstlichkeit und die neuroendokrine Antwort auf sozialen Stress. Männliche Präriewühlmäuse beispielsweise, die zahlreiche Oxytocinrezeptoren in den Belohnungsarealen ihres Gehirns besitzen, sind monogam und kümmern sich um ihren Nachwuchs. Die mit ihnen genetisch nahe verwandte Bergwühlmaus hingegen, die kaum Oxytocinrezeptoren in den Belohnungszentren ihres Gehirns besitzt, ist polygam und die Männchen zeigen keine elterliche Fürsorge.
Behandlung von sozialen Disfunktionen möglich
Bei Menschen wird Oxytocin während des Stillens, der Geburt und während des Orgasmus ausgeschüttet. Wie der Zürcher Psychologe Markus Heinrichs in einer früheren Studie gezeigt hat, reduziert Oxytocin die Ängstlichkeit und steigert den stressausgleichenden Effekt, den soziale Unterstützung hervorruft. „Unsere neuesten Ergebnisse könnten positive Auswirkungen auf die Behandlung von Patienten mit psychischen Störungen im Bereich des Sozialverhaltens haben. Zu diesen Störungen gehören etwa soziale Phobie und Autismus.“
Die soziale Phobie ist die dritthäufigste psychische Störung. Menschen mit sozialer Phobie haben Angst in sozialen Situationen und vermeiden Kontakte. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass Oxytocin die psychotherapeutische Behandlung sozialer Ängste entscheidend ergänzen könnte.
Die Forscher berichten über ihre Ergebnisse in der aktuellen Ausgabe des Wissenschaftsmagazins Nature.
(idw – Universität Zürich, 02.06.2005 – DLO)