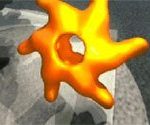Veränderungen des Erbguts sind „schuld“ daran, dass bei Patienten mit so genannter Spinaler Muskelatrophie Nervenzellen im Rückenmark absterben, die Muskeln steuern. Die Folge: Muskelschwäche und Lähmungen. Vor allem für Kinder und Jugendliche mit dieser angeborenen Krankheit gibt es bislang nur wenige Therapiemöglichkeiten. Wissenschaftler vom Biozentrum der Uni Würzburg haben jetzt einen Ansatzpunkt gefunden, über den sich möglicherweise die Situation von Patienten mit Spinaler Muskelatrophie verbessern lässt.
{1l}
Die Spinale Muskelatrophie ist eine Erbkrankheit, die im Kinder-, Jugend- oder Erwachsenenalter auftreten kann. Bei besonders schlimmen Formen sterben die Betroffenen wegen einer ausgeprägten Muskelschwäche und fortschreitenden Lähmungen schon im Säuglingsalter. Bei anderen können die Ärzte durch Krankengymnastik und orthopädische Hilfsmittel die Mobilität und Vitalität für längere Zeit erhalten.
Die Spinale Muskelatrophie ist nicht selten: Sie trifft etwa einen von 6.000 Menschen. Auf Grund einer Veränderung des Erbguts besitzen die Betroffenen zu wenig von dem Protein SMN (Survival Motor Neuron). Ein Mangel, der sich besonders in denjenigen Nervenzellen im Rückenmark zeigt, die die Bewegung der Muskeln steuern: Diese so genannten Motoneuronen verlieren den Kontakt zum Muskel und sterben ab und es kommt zu zum Teil schweren Lähmungen.
Protein als Maschinenbauer
In den vergangenen Jahren haben Forscher herausgefunden, dass SMN in allen Körperzellen maßgeblich daran beteiligt ist, die Erbinformation aus der DNA abzurufen. „Dieses Protein übernimmt die Rolle eines Maschinenbauers: Es konstruiert aus mehreren Einzelteilen eine Maschine, die dann im Zellkern eine wichtige Rolle spielt“, erklärt Utz Fischer.
Genau diese Maschine – die Forscher sprechen von einem „Ribonukleoprotein-Partikel“ – spielt beim Absterben der Nervenzellen offenbar eine tragende Rolle. Das hat Biochemiker Fischer mit Kollegen aus der Würzburger Physiologischen Chemie herausgefunden: Wenn zu wenige SMN-Proteine vorhanden sind, entstehen auch nicht genug von den Maschinen, und die für Muskelbewegungen so wichtigen Nervenzellen gehen zugrunde. Das zeigte sich bei Experimenten mit Zellkulturen und Zebrafischen.
Vorgefertigte Maschinen als Ersatz
Als die Forscher bei den Tieren die Aktivität des SMN-Gens unterdrückten, starben die Motoneuronen ab. Injizierten sie den Tieren aber gleichzeitig funktionsfähige Maschinen, blieben die Nervenzellen erhalten und wuchsen normal. In einer anderen Versuchsreihe wurden bei gesunden Fischen Faktoren unterdrückt, die quasi als Assistenten des Baumeisters wirken, die also zusammen mit dem SMN-Protein für den Aufbau der Maschinen nötig sind. Auch in diesem Fall starben die Nervenzellen ab – obwohl genug SMN da war. Daraus schließen die Forscher vom Biozentrum: Der Baumeister und seine Assistenten können durch das Einbringen vorgefertigter Maschinen ersetzt werden.
Damit haben die Würzburger Forscher einen weiteren Ansatzpunkt gefunden, der womöglich einen Therapieweg bei Spinaler Muskelatrophie öffnet: Man könne versuchen, die Produktion der Maschinen zu stimulieren, so Fischer. Eine andere Strategie wird in der experimentellen Forschung seit längerem verfolgt: Man erhöht dabei die Menge an SMN-Protein, indem man das SMN-Gen zu größerer Aktivität antreibt. Bei den Patienten ist dieses Gen nämlich vorhanden, aber aufgrund von Mutationen funktioniert es nicht gut genug.
Die Forscher haben mit ihrer Studie dazu beigetragen eine wichtige Frage in der Biochemie zu klären: „Wenn ganz allgemeine Stoffwechselwege, die in allen Zellen gleich laufen, geschwächt sind, wirkt sich das nicht zwangsläufig auf alle Zellen gleichermaßen fatal aus. Vielmehr kann es, wie im Fall der Spinalen Muskelatrophie, zum Untergang ganz definierter Zellen oder Gewebe kommen“, sagt Fischer. Weitere Forschungen sollen klären, warum der „Maschinenmangel“ zwar die Motoneuronen beeinträchtigt, nicht aber die anderen Zellen des Körpers.
Die Wissenschaftler berichten über ihre Ergebnisse die Forscher in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Genes & Development“.
(idw – Universität Würzburg, 18.10.2005 – DLO)